Edmund A. Spindler
Von einer Biografie, die mit einem Prolog über den „Tod im Krankenzimmer“ beginnt, 668 Seiten lang ist und mit Erinnerungen an die „goldene Mondsäule“ endet, kann man viel erwarten. Eine solche themengesättigte und umfangreiche Biografie hat der norwegische Schriftsteller Atle Naess (*1949) über Edvard Munch (1863-1944) geschrieben. Die Originalfassung wurde im Mai 2004 in Norwegen veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung von Daniela Stilzebach (*1978) liegt seit August 2015 im Verlagshaus Römerwald in Wiesbaden vor.
Es ist eine Biografie der Spitzenklasse, die zwar chronologisch vorgeht und viele Details im Leben von Edvard Munch beschreibt, aber auch romanhafte Züge mit diversen Ausschmückungen enthält.
Inhalt
Die chronologischen Inhalte sind in neun Lebensabschnitte unterteilt und das Wesen und Wirken von Edvard Munch wird diesen Kapiteln zugeordnet:
- 1863-1885
- 1885-1892
- 1892-1898
- 1898-1902
- 1902-1905
- 1905-1908
- 1908-1914
- 1914-1927
- 1928-1944
Diese Aufteilung macht Sinn und wäre auch für das Munch-Museum eine Hilfe bei der Darstellung von Munchs Werken.
Naess geht es in seiner faktenreichen Biografie darum, den Menschen Edvard Munch umfassend zu charakterisieren und die personenbezogenen Lebensumstände und Einflüsse auf seine Kunst zu erfassen. Zur Sprache kommen dabei die intensive über 60 Jahre andauernde Schöpferkraft von Edvard Munch, seine Stärken und Schwächen sowie seine Freundschaften und sein Verhältnis zu Frauen. Auf Letzteres geht die Biografie ausführlich ein. Naess schildert u.a. das dramatische Verhältnis zu Tulla Larsen kapitelübergreifend auf vielen Seiten.
Ein weiterer Schwerpunkt in der Biografie ist der Naturbezug von Edvard Munch, den Atle Naess mit dem Monismus des Biologen Ernst Haeckel andeutet und erklärt: „Munch entwickelte eine Art hausgemachte Naturphilosophie mit Ausgangspunkt in der Kristallisation.“ (S. 147). Inhaltliche Bezüge hierzu finden sich auch auf den Seiten 235 f und auf der Seite 471. Es ist verwunderlich, dass diese Erkenntnisse von Atle Naess in der bisherigen Munch-Forschung nicht noch tiefer aufgegriffen wurden.
Auch erkennt man in der Biografie eine Hinwendung von Edvard Munch zu Tendenzen des Kunstgeschehens und zur Geistesgeschichte, insbesondere Literatur, Dramaturgie und Philosophie, in Europa. Dabei werden seine Beziehungen speziell zu Deutschland und zu seinen Artgenossen, Unterstützern und Mäzenen, die z.T. langjährige Freunde wurden, in der Biografie lebhaft und profund dargestellt.
Bemerkenswert ist, dass Naess in seiner „Danksagung“, die sich auf insgesamt 48 Personen bezieht, auch einige Deutsche namentlich erwähnt, die ihm bei der Recherche geholfen haben. Hierzu gehören u.a. Frau Dr. Brigitte Heise aus Lübeck, Dr. Ulrich Luckhardt, der die Munch-Ausstellung in Ingelheim erst kürzlich kuratiert hat (www.internationale-tage.de), Helmut Rose aus Elgersburg (www.edvard-munch-rundwanderweg-elgersburg.de/galerie) und Lutz Toepfer aus Bad Kösen.
Angereichert ist die Biografie mit einer Vielzahl von Originalfotos und einigen bekannten Bildern und Zeichnungen von Edvard Munch. Das Text-Bild-Verhältnis entspricht dem Charakter einer anschaulichen Biografie.
Besonders hilfreich als Nachschlagewerk ist das Personen-Register am Ende des Buches. Leider fehlt ein Sachregister, das bei der Fülle von Informationen auch sinnvoll gewesen wäre. Im Personen-Register sind fast 400 Namen erwähnt, auf die die Biografie direkt eingeht. Allein schon dieser Umfang an Personen zeigt, wie umfassend und gründlich Naess gearbeitet hat und wie nah er Munch und seinem Umfeld gekommen ist. Auffällig ist, dass die Namen in seinem familiären Umfeld am häufigsten genannt werden. Zum Beispiel wird auf seine Tante Karen Bjolstad, die Munch als Mutter-Ersatz akzeptierte und die ihn schon früh künstlerisch unterstützte, 83-mal und auf seine Schwester Inger Munch 52-mal hingewiesen. Dies ist ein Beleg für die These von Atle Naess, dass Munch stets eine „moralische Verantwortung gegenüber der Familie zu Hause“ hatte (S. 186).
Auch drei deutsche Freunde glänzen mit hohen Zitierwerten: Dr. Max Linde (48-mal) und Gustav und Luise Schiefler (77-mal). Aus dieser Bilanzierung lassen sich Schlüsse zu den Themen in der Biografie ableiten und Inhalte verifizieren. D.h. der Bezug von Munch zu Deutschland, in der er über ein Jahrzehnt an verschiedenen Orten gelebt hat, spielt in der Biografie eine große Rolle.
Naess geht streng und lobend auf das erste Munch-Buch ein, das Stanislaw Przybyszewski 1894 in Berlin herausgegeben hat (S. 155 f). Auch erläutert er die Umstände verschiedener Ausstellungen von Munchs Gemälden und Grafiken in Deutschland. Die „Skandal-Ausstellung“ im November 1892 in Berlin, die nur fünf Tage lang geöffnet war, wird ausführlich behandelt. Und er widmet sich der Sonderbund-Ausstellung im Mai 1912 in Köln, bei der Munch neben van Gogh, Cézanne und Gauguin mit 32 Gemälden prominent vertreten war. Dabei resümiert er: „Die Sonderbund-Ausstellung wurde zu Munchs endgültigen Durchbruch in Deutschland“ (S. 436). Durch diesen Erfolg in Deutschland hat sich das Leben von Edvard Munch auch in Norwegen grundlegend gewandelt; er ist (endlich) „museumsreif“ und ein international gefeierter Künstler geworden!
Auf die letzten 35 Jahre von Munch in Norwegen geht Naess sehr respektvoll und mit großer Bewunderung ein. Vor allem das Leben von Munch ab 1916 auf seinem Gut Ekely in Oslo wird in der Biografie mit großer Empathie dargestellt. Doch die Biografie endet nicht wie erwartet mit dem Tod und der Beerdigung von Edvard Munch, sondern mit einem Hinweis von Naess auf den „schönen Mondschein“ (S. 570), der für Munchs Kunst so prägend war, eine Stimmung ausdrückt und sein Verhältnis zur Natur kennzeichnet. Chapeau!
Fazit
Die Biografie liefert tiefe Einblicke in das Leben von Edvard Munch. Mit dem Blick des Autors auf den Avantgardekünstler Munch kommt man dem Mythos des einsamen Künstlergenies sehr nahe, auch wenn dies in voller epischer Breite geschieht und manchmal mehr Präzision und Leseeffizienz (z.B. in Form eines detaillierten Zeitstrahls) hilfreicher gewesen wäre. Dennoch: Wer sich mit Munch eingehend beschäftigt, kommt an der Biografie von Atle Naess nicht vorbei. Sie ist inhaltlich wertvoll und ein besonderes Prunkstück.
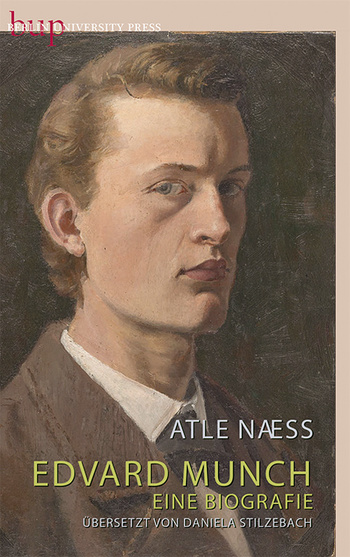
Zum Original der norwegischen Ausgabe schreibt der Verlag im Jahr 2004 u.a.:
„Die erste moderne Biografie von Edvard Munch. Eine fesselnde Geschichte über Kunst und Liebe.“
und
„Atle Naess, Schriftsteller und Kunstkenner, bietet ein großartiges und atemberaubendes Leseerlebnis. Das Buch ist reich mit Munchs Kunst und Fotografien illustriert.“